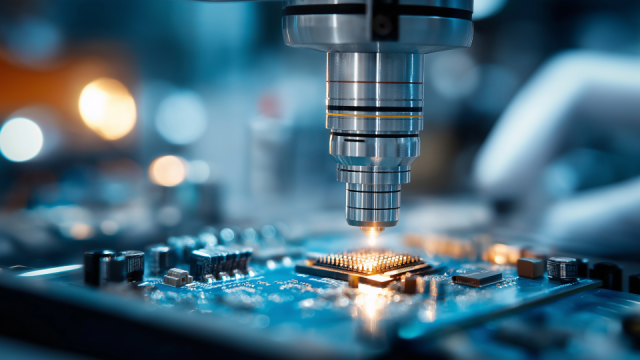CSRD-konforme Nachhaltigkeits-Berichterstattung
-
Unternehmen
Das Projekt wurde von dem Interim Manager im Auftrag eines Providers durchgeführt.
Ein international tätiger Automobilzulieferer mit ca. 900 Mio. € Umsatz und rund 2.000 Mitarbeitenden an weltweiten Standorten.
-
Ausgangslage
Das Unternehmen stand mitten in der Transformation: Elektrifizierung, volatile Märkte und gestiegene ESG-Anforderungen erhöhten den Druck. Eine Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD wurde notwendig – nicht nur zur strategischen Ausrichtung, sondern auch zur Sicherung einer Refinanzierung über ein internationales Bankenkonsortium.
-
Painpoints
- Datenverfügbarkeit und -qualität In einem Unternehmen im Wandel waren relevante ESG-Daten nicht vollständig, in Silos verteilt oder nicht in geeigneter Qualität vorhanden. Insbesondere internationale Standorte erschweren eine konsistente und prüfbare Datenerhebung.
-
Ressourcenkonflikte in der Transformation → Die Organisation war bereits stark durch Projekte wie Elektrifizierung, neue Lieferkettenanforderungen und der laufende Restrukturierung belastet. Zusätzliche Anforderungen aus der CSRD verschärfen interne Kapazitätsengpässe und Abstimmungsprobleme.
-
Reputations- und Finanzierungsrisiken → Fehlerhafte oder verzögerte ESG-Berichte gefährden nicht nur die geplante Refinanzierung, sondern auch die Reputation bei OEM-Kunden, die zunehmend Nachhaltigkeitskriterien in die Lieferantenauswahl integrieren.

Aufgabenstellung
Implementierung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung bis Ende 2024 gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Schwerpunkt war die Entwicklung und Durchführung der Wesentlichkeitsanalyse, eine effiziente und zielgerichtete Stakeholderbefragung, die Implementierung und Automatisierung der Dateneruierung bzw. der Datenerhebung.
Besonders beachtet werden sollen Risiken, die sich aus der Transparenz in geoppoltisch riskanten Regionen ergeben könnten und wie Ressourcenkonflikte innerhalb des Unternehmens vermieden werden können.
Vorgehensweise
Die doppelte Wesentlichkeitsanalysebildete die Grundlage. Bewertet wurden sowohl die Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft (Inside-Out) als auch finanzielle Risiken durch Nachhaltigkeitsthemen (Outside-In). In einem vierstufigen Prozess wurden relevante Themen identifiziert und priorisiert. Workshops mit diversen Fachabteilungen wie Produktion, Logistik, Fuhrparkmanagement, Controlling und HR führten zu einer unternehmensweiten Impact Map.
Externe Stakeholderwie OEM-Kunden, Lieferanten, NGOs und Behörden wurden über Online-Umfragen, Interviews und Workshops eingebunden. Die Durchführung dauerte rund zwei Wochen und lag bei der Kommunikationsabteilung, eine Auswertung erfolgte separat nach definierten Kriterien.
Ein ESG-Dashboard aggregiert seitdem Daten aus diversen Systemen (Energiemanagement, ERP,...) und wird über ein DWH als Single Point of Truth gespeist. Automatisierte Updates und definierte KPIs gewährleisten Effizienz und Vergleichbarkeit. Die Datenqualität wird durch genaue Definitionen, standardisierten Schnittstellen, klaren Verantwortlichkeiten und diversen Validierungen (Vergleich zum Vormonat, RedFlag-Indikatoren etc.) sichergestellt.
Ressourcenkonflikte wurden vermieden durch Erstellung einer Roadmap, insbesondere
-
Frühzeitige Projektplanung und Priorisierung
-
Etablierung eines dedizierten CSRD-Projektteams
-
Integration in bestehende Transformationsprogramme
-
Nutzung externer Unterstützung (Interim-Manager)
-
Schulung und gezielter Aufbau von ESG-Kompetenzen intern
-
Realistische Zeit- und Ressourcenplanung mit Pufferzeiten
Ergebnis
Im Rahmen der CSRD-Einführung ergeben sich aus Wesentlichkeitsanalyse, Stakeholderbefragung und Datenerhebung folgende zentrale Ergebnisse und Zielzustände, die die Grundlage für die anstehende Vorprüfung durch den Wirtschaftsprüfer bilden:
1. Wesentlichkeitsanalyse Themenpriorisierung: Eine dokumentierte Liste wesentlicher Nachhaltigkeitsthemen, aufgeteilt nach Umwelt (z.B. Klimawandel, Ressourceneffizienz), Sozialem (z.B. Arbeitssicherheit, Menschenrechte in der Lieferkette) und Governance (z.B. Antikorruption, Compliance).
-
Doppelte Wesentlichkeit: Die Themen sind sowohl hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft ("Impact Materiality") als auch auf finanzielle Risiken und Chancen des Unternehmens ("Financial Materiality") bewertet.
-
Transparente Methodik: Beschreibung des Prozesses (z.B. Bewertungsmatrix, Scoring-Logik, Beteiligte) liegt vor, um die Nachvollziehbarkeit und Prüfungssicherheit zu gewährleisten.
2. Stakeholderbefragung
-
Stakeholder-Einbindung: Dokumentation, welche Gruppen befragt wurden (z.B. Kunden, Lieferanten, Mitarbeitende, Banken, Behörden) und welche Methoden (Online-Umfrage, Interviews) zum Einsatz kamen.
-
Ergebnisse: Auswertung der Stakeholdermeinungen hinsichtlich Relevanz und Priorität von ESG-Themen; Übereinstimmungen und mögliche Divergenzen zur internen Einschätzung werden dargestellt.
-
Ableitung der Stakeholder-Perspektiven: Integration der Stakeholderinputs in die finale Wesentlichkeitsmatrix.
3. Datenerhebung
-
Datensätze und KPIs: Erste Erhebung von Kernkennzahlen (z.B. Scope-1-Emissionen, Frauenanteil Führung, Verletzungen Compliance-Richtlinien) auf Basis klar definierter Datenquellen und Berechnungsmethoden.
-
Datenqualität: Dokumentation der Quellen, Erfassungsmethoden und ersten Plausibilitätschecks. Erste Abweichungen oder Datenlücken sind identifiziert und mit Maßnahmen zur Korrektur versehen.
-
Automatisierungsgrad: Einschätzung, inwieweit Daten automatisiert aus bestehenden Systemen bezogen werden können oder manuelle Erhebungen notwendig sind.